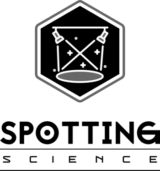Egon Erwin Kisch unternahm während seinem Exil in Mexiko ab 1939 zahlreiche Reisen quer durch das Land. Er berichtete von seinen Entdeckungen und Eindrücken, auf meist recht unterhaltsame Weise, in Reportagen, die seit Beginn der 1940er Jahre laufend in Exilzeitschriften (v.a. in der Zeitschrift Freies Deutschland) erschienen [1]. Unter anderem schrieb er ein Märchen über die Glimmerprinzessin Mica, welches auch heute, rund 80 Jahre später, noch immer recht aktuell ist.
DAS MINERAL DER MOTORISIERTEN MENSCHHEIT [2]

Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Mica und lebte tief im Berg drinnen. Bei ihrer Geburt waren die Feen vollzählig an ihrer Wiege erschienen und jede hatte ihr eine Gabe gespendet, so daß es im ganzen Reich, dem Mineralreich, kein Wesen gab, welches ihr gleichkam an Fülle edler Eigenschaften.
Schlanker und biegsamer als die Fee selbst, die ihr Schlankheit und Biegsamkeit verliehen hatte, war Mica dennoch nicht schwächlich. Im Gegenteil, die hauchdünne Prinzessin setzte allen Elementargewalten so viel Widerstandskraft entgegen, daß sich die bärbeißigen Blöcke aus Fels und Erz daran ein Beispiel nehmen konnten. Glut und Feuer vermochten ihr nichts anzuhaben, selbst wenn sie sie jahrelang umzingelten, nicht einmal heiß wurde sie im lodernden Feuer. Im Wasser rostete sie nicht. Frost machte ihre zarte, durchsichtige Haut nicht rauh. Keine Säure war imstande, ihr ein Fleckchen in den klaren Leib zu ätzen; und ein Blitz, so nahe von ihr er auch einschlug, sah sich um jegliche Wirkung betrogen. Dabei war Mica schön wie Blumentau, mochte sie nun ein schwärzlich schimmerndes Gewand tragen oder ein goldenes oder ein perlmutternes oder eines mit mattem bernsteinfarbigem Fond.
Der Mensch, der, von ihrem Gleißen verführt, geil auf sie zustürzte, stieß einen Fluch aus, als er erkannte, daß sie kein Edelstein oder kein Edelmetall sei, sondern aus Katzengold oder Katzensilber, ganz gewöhnliches Marienglas, Moskowiterglas, schäbiger Glimmer, Alkali-Tonerde-Silikat. Höchstens nahm er ein paar Stücke mit, um sie in den Ofen als Fenster einzusetzen. Durch solche Fensterscheiben, die nicht zerspringen, teilte sich die Kohlenglut als Licht dem Raume mit und man konnte auch in den Ofen sehen, was freilich eine mehr oder minder überflüssige Sache war.
Eines Tages aber begann draußen, außerhalb des Berges, das Geschlecht der Menschen sich die elektrische Kraft der Natur nutzbar zu machen und entdeckte, daß hierzu Prinzessin Micas Hilfe vonnöten sei. Von Stund an hörte das Märchen auf, ein Märchen zu sein, und Schön Mica ward zu einer Ware, zu einem Verkaufsgegenstand oder zu einem Handelsartikel oder wie ihr sie sonst nennen wollt, – nur Prinzessin dürft ihr sie nicht nennen, wenn ihr euch nicht das Hohngelächter der Männer zuziehen wollt, die mit ihr zu tun haben.
Einige dieser Männer holen mit Spaten und Hacke, mit Lufthammer und Sprengstoff die Mica aus dem Bergesinneren, tun also jene Arbeit, ohne die keine weitere möglich ist. Deshalb führen sie auch das elendste Leben. Im mexikanischen Staat Oaxaca führen sie es an schwer zugänglichen Stellen. An einigen dieser Stellen läuft zwar nunmehr der Panamerican Highway vorbei, aber das nützt den Männern im Micaberg nichts. Denn sie stammen nicht aus New York oder aus Buenos Aires, sondern meistens aus irgendeinem Dorf, das an keiner Straße liegt, am allerwenigstens am Panamerican Highway. Und wäre auch das Dorf so bequem mit dem Arbeitsplatz verbunden, was würde es dem Indio-Arbeiter nützen? Kein Indio-Arbeiter hat ein Auto, und die Leute die Autos haben, nehmen darin keinen Indio-Arbeiter mit. So wohnen die Arbeiter nicht in ihrem Dorf, sie wohnen am Arbeitsplatz, wo es noch primitiver ist als zu Hause. Manch einer, der neu Angeheuerte zum Beispiel, schläft bei der Exprinzessin Mica, was ein rauhes Liebeslager ist, auch wenn er seinen Sarape auf den Boden des Stollens ausbreitet. Wer länger hier ist, richtet sich ein Hüttchen auf und deckt es mit Stroh, ein Obersteiger vielleicht mit Dachpappe. Nicht von Pappe jedoch ist das Baumaterial (oder soll man Baum-Material sagen?) dieser Elendshütten. Es ist aus dem Holz der edelsten Bäume, die hier überall wachsen und aus dem die irdischen Standesgenossinnen der Prinzessin Mica höchstens ein Schmuckkästchen besitzen.
Kleiner ist die Hütte als das Auto, das an ihr vorüberfährt, und das Gärtchen hinter ihr ist noch kleiner als die Hütte. Nur wenig Mais und Bohnen gibt es her, und es läßt sich nicht vergrößern, denn der Boden ist der harte Stein, darin die schöne Mica liegt.
Einst, als sie noch Prinzessin war und weltliche Wünsche hegte, zeigte sich Mica manchmal draußen auf der Erdoberfläche, wie um zu sagen: „Nimm mich hin.“ Jetzt scheint sie von Hinnahme und Hergabe genug zu haben, sie verbirgt sich tief.
Dadurch bekommt die Micaförderung einen Charakter des Suchens, des Aufspürens, der Jagd, vor allen in dem durch Erdbeben in Unordnung gebrachten Boden Mexikos. Hier streckt sich die Mica nicht als Ader oder als Flöz hin, sie lagert nicht immer im gleichen Muttergestein, ja nicht einmal in der gleichen geologischen Schicht. Einmal im Vulkanischen, einmal im Sedimentären, sitzt sie in Taschen, die miteinander weder in mineralogischer noch sonst wie logischer Beziehung stehen.
Vom Nordpol bis zum Südpol sind alle verwertbaren Inhalte der Erde, die Erze, Öle und Minerale, errechnet oder geschätzt – wieviel Mica es gibt, weiß man jedoch nicht; ebensowenig weiß man, ob es nicht morgen oder übermorgen mit ihr zu Ende sein wird. Schwerlich verbirgt sich die Mica vor der Weltwirtschaftsstatistik, viel wahrscheinlicher ist es, daß sie den konkreten Spaten des konkreten Bergmanns fürchtet, der sie bloßlegen will.
Daß sie im Berg ist, weiß man. Durch Erdveränderungen, Wasserabflüsse und Regen geraten Splitter an die Oberfläche und verraten dem, der es wissen will, daß er sich über Mica befindet. Nichts aber verrät ihm, an welchen Stellen sie steckt. Denn sie steckt unten so angeordnet wie Rosinen im Napfkuchen, das heißt: gar nicht angeordnet. Beim Kuchenessen schneidet sich der eine Schnitte nach Schnitte ab, ohne auch nur eine einzige Rosine zu erhaschen, der andere hat ihrer viele gleich in der ersten Scheibe. Von außen her kann man nicht sehen, wo die Rosinen im Kuchen stecken und die Mica im Berg.
Kreuz und quer muß der harte Kuchen geteilt werden. Kein anderes Bergwerk auf Erden ist so unregelmäßig, so formlos, so anarchistisch wie das der Mica. Es kennt nicht die geometrischen Begriffe von Ebene und Gerade, der Außenhang ist in Höhlungen und Risse dergestalt zersprengt, daß er aufgehört hat, Wand zu sein, und selbst die Stollen und Schächte krümmen sich. Das Röhrenwerk, das die Preßluft aus dem Bretterhaus der Motoren und Kompressoren zu den Maschinenhämmern führt, stellt ein wahres Wirrsal dar.
Die bohrenden Arbeiter stehen nicht auf gleicher Höhe und bilden keine Reihe noch sonst eine ersichtliche Konstellation. Einige drücken ihre Bohrer nur vierzig Zentimeter tief ins Hangende, während andere das Bohrloch vier Meter tief ins Liegende treiben. Auch das Quantum des Dynamits wechselt: manchmal wird nur eine Patrone versenkt, manchmal drei bis vier, mehr aber niemals, denn ein zu starker Schnitt in den Leib des Berges würde das Organ verletzen, auf das es die Operatoren abgesehen haben.
Mit der Sprengung ist die Formlosigkeit des Felsens in eine andere Formlosigkeit verwandelt. Die wird nun abgesucht. Es kann sein, daß aus der neu entstandenen Fassade ein Micabündel hervorglitzert. Es kann auch sein, daß irgendwo das fahle Gesicht des Feldspats auftaucht und verräterisch zwinkert, des alten Leibwächters der Mica, hinter dessen Rücken sie sich zu verstecken pflegt. Es kann schließlich auch sein, daß entlang der ganzen Bruchstelle weder die Prinzessin noch ihr ungetreuer Beschützer sichtbar werden, noch sonst ein Anzeichen dafür, daß sie hier residiert.
Haben aber ihre Verfolger die Mica erreicht, so wird sie mit Respekt, Vorsicht und Zartheit entführt. Mit einer metallenen Spachtel, der „barrena“, hebt man sie aus ihrem Bett, wenn es nicht genügt, sie mit der Hand zu heben. Dann setzt man sie in die Sänfte, die freilich nur ein eiserner Grubenhund ist, und geleitet sie in ihr neues Heim, welches freilich nur der grobgezimmerte Lagerraum des Bergwerks ist, und hernach hoch zu Roß, welches freilich nur ein mageres Maultier ist, zur Landstraße, wo der Wagen wartet, ach Prinzessin, keine Hofkalesche, nur ein Lastauto.
Nächster Séjour ist die Großwerkstätte, die nicht zu diesem Zweck gebaut ist. Vorbei sind die Glanzzeiten von Oaxaca. Als es der Umschlagplatz vom Pazifik zum Atlantik war, standen manchem Fuhrwerksbesitzer zweitausend Maulesel und Hunderte von Karren in seinem Stall. In Übersee harrten Textilstoffe, blaß vor Erwartung, auf die Kochenille, die Färberlaus von den Kakteen Oaxacas. Am Wege lagerten Männer, um Warentransporte zu überfallen; wenn sie vor der Obrigkeit in die Berge flüchteten, konnten sie eine Goldmine entdecken und dann als reiche, das heißt ehrenwerte Bergwerksbesitzer in der Stadt Oaxaca Bürgerrecht erwerben.
Aus dieser Konjunkturperiode stammen die Paläste. Ihre Portale waren breit genug, die größten Karossen zu empfangen; im Patio, dem maurischen Hof, sprudelte ein Springbrunnen, und die Gäste vergnügten sich paarweise hinter dem blütenschweren Gesträuch. Massiv und ebenerdig sind die Gebäude, denn bei einem Erdbeben wäre ein oberes Stockwerk eingefallen; die wenigen Häuser in Oaxaca, die eine erste Etage haben, wirken wie Wolkenkratzer.
In ein solches Patrizierhaus fährt die Mica nun ein, nach jahrhundertelanger Residenz im Bergesinnern. Kein Patrizierhaus mehr, ein Betrieb. Schön-Mica ist im Sortierraum. Sie zittert. Wozu sortiert man mich? Wozu schneidet man meine Ränder und Zacken weg, wozu wägt man mich, was wird mit mir geschehen?
Auf dem Kamin steht ein riesiger Mica-Kristall, der wohl seine vierzig Kilo schwer ist. Wenn ich von ihm auf meine Zukunft schließen dürfte, hätte ich Hoffnung, gleichfalls heil zu bleiben. Aber sicherlich ist mein hochaufgeschossener Verwandter da nur als Abnormität, als Ausnahme zur Schau gestellt. Oh, wär ich doch auch so groß! Aber ich bin klein, und dennoch beschneidet man mich, teilt mich in Pakete von zwei Kilogramm ein und bringt mich in den Hof.
Der Hof ist voll von Tischen. Frauen sitzen um sie herum, auch unter den Arkaden arbeiten Frauen und Mädchen. Nur am steinernen Rand des Springbrunnens, in dem längst kein Wasser mehr spielt, sitzen Männer. Sie schleifen Messer, Messer für die Frauen und Mädchen, die mit vermummten Gesichtern auf die neugeschliffenen Waffen und auf neue Beute warten.
In der Luft glitzert und glimmert es wie von winzigen Libellen. Um dieser Partikelchen der Mica willen hängt die behördliche Anordnung an der Wand, daß das Tragen von Masken obligatorisch ist. Um dieser behördlichen Anordnung willen tragen die Mädchen und Frauen eine Binde aus Gaze über Mund und Nasenlöcher. Um dieser Binde willen hängt der behördlichen Anordnung ein Plakat gegenüber. Es stammt von den Unternehmern und bezeichnet sowohl Masken wie Binden als überflüssig und arbeitshemmend. Die Tätigkeit an der Mica sei vollkommen unschädlich. Bei der Arbeit an Quarzen oder anderen Kristallen zementieren sich die Mineralstäubchen in der Lunge und verursachen Verhärtung und Zerstörung der elastischen Gewebeteile. Mica aber sei unlöslich und könne daher, auch wenn sie geschluckt wird, keine Silikosis hervorrufen.
Daß die Mica-Arbeiter unverwundbar seien, könnte hier kein Plakat behaupten, denn es gibt unter den 250 Frauen kaum eine, die nicht an drei, vier Fingern der linken Hand einen Verband oder ein Pflaster trägt. Sie verletzen sich mit dem spitzen, grifflosen Messer in ihrer Rechten, wenn es eine Haarbreite abseits fährt von dem Mineral, das sie in der linken Hand halten, um es parallel zu seiner Basis in Blätter zu spalten. Mit der Geschwindigkeit eines Weberschiffchens saust das Messer gegen die Mica oder eben eine Haarbreite daneben. Eine Haarbreite bedeutet ein großes Ausmaß in diesem Betrieb, ist doch ein Blatt oft nicht dicker als das Zweihundertstel eines Millimeters, weit dünner als Seidenpapier.
Der Meßapparat, der an jeden Arbeitstisch geschraubt ist, mißt die Dicke des fertigen Arbeitsprodukts auf Bruchteile eines Millimeters genau. Ebenso genau wird die gespaltene Mica gewogen und hernach zum Gewicht des Abfalls addiert, der während der Arbeit in ein Kästchen im Schoß der Arbeiterin fällt. Zusammen muß das so viel Gewicht ergeben, wie das Rohmaterial hatte, das der Arbeiterin am Morgen zugeteilt wurde, 250 Gramm bis zwei Kilo. Der gleichen Kontrolle werden auch die Heimarbeiter unterzogen. Denn Einkäufer aller Art treiben sich im Micagebiet umher und finden ihren Weg nicht nur zu Bauern, die beim Pflügen auf Glimmer stoßen, sondern auch zu den Bergleuten auf der Grube, zu den „Micaelas“, den Arbeiterinnen in der Werkstatt, und zu den „Destajos“ den Heimarbeitern, die das Rohprodukt von der Fabrik zugewiesen bekommen.
Dreier Sorten von Mica bedarf die Industrie. Nummer eins heißt „Block“. Das ist eine Tafel, je größer um so besser. Sie kann zwanzig Quadratzentimeter groß und einige Millimeter dick sein, ohne fürchten zu müssen, daß ihr das Messer der Micaela, in den Leib fährt, um sie zu spalten. So wie er ist, geht der Block zu General Electric oder zu Westinghouse, wo ein einziger Arbeitsgang genügt, aus ihm das Endprodukt für elektrische Maschinen zu stanzen.
Nummer zwei heißt „Buch“. Wie jedes andere Buch besteht es aus Blättern, aus fünfundzwanzig bis hundert Blättern. Freilich sind sie nicht aus bedrucktem Papier und nicht vom Buchbinder gebunden, sondern aus blanker Mica und mittels einer gewöhnlichen Papierklammer zusammengehalten. In den Motorenwerken von Nordamerika werden die Blätter in die elektrischen Apparate gelegt, um darin das zu isolieren, was zu isolieren ist.
Nummer drei, das „Splitting“ ist weitaus die dünnste Mica. Sie wird nicht in der Form verwendet, in der sie von hier versandt wird, ihr steht noch eine Transsubstantiation bevor. Drüben in USA, in der Bostoner Micanitfabrik, werden die Splittings sorgsam übereinandergelegt, mit Schellack verbacken und hydraulisch gepreßt. Aus dem solcherart entstehenden Micanit, Kunstglimmer oder „built-up Mica“ lassen sich die hundert Formen für hundert Arten von elektrischen Apparaturen schneiden, sogar Röhren, runde und eckige. Wo immer sich im allerengsten Raum eines Motors Hochspannungen gegenüberstehen, einander provozieren, stellt sich die zarte Mica zwischen die feindlichen Nachbarn und verhindert, daß sie mit verheerenden Blitzen aufeinander losgehen.
Kein Radio spricht, kein Röntgenapparat sieht ohne ihre Hilfe, ohne ihre Hilfe fliegt kein Flugzeug und kein elektrisches Bügeleisen hin und zurück. Ohne sie würde kein Dauerweller der Kundin im Friseursalon und kein Tank dem Feind ein Haar krümmen. Die Mica ist es, die die Zündkerze im Motor und die Platten des Kondensators vor Unbill bewahrt. Ohne ihre isolierende Tätigkeit hätte sich die Elektro-Industrie ganz anders entwickelt. Wenige Stoffe gibt es, deren Versiegen so schwere Wirtschaftsstörungen hervorrufen würde, wie das Verschwinden der Mica.
Erschwert wäre vor allem der motorisierte Krieg. Die Zeitschriften für Bergbau und Elektrizität betonen schon im Frieden die Wichtigkeit von Mica für das Kriegspotential. Sorgfältig sind diese Artikel in den Archiven der Micagesellschaften aufbewahrt, und es ist belehrend, sie im Krieg nachzulesen.
„Der Rückgang der deutschen Kriegsleistung in den Jahren 1916 bis 1918 ist fast ausschließlich auf Mangel an Mica zurückzuführen“, stellt ein englischer Fachmann 1939 im „Mining Journal“ fest, fügt aber anerkennend hinzu, daß Deutschland nunmehr enorme Käufe von Bengal-Mica zu fairen Preisen tätige. Der englische Fachmann kam nicht mehr dazu, nachzutragen, daß ein paar Monate nach Erscheinen seines Artikels England bombardiert wurde, dank dieser von Deutschland zu fairen Preisen enorm gekauften britischen Mica.
Um die gleiche Zeit fühlten die Japaner ihre Bezugsquellen im indischen Bihar und im französischen Madagaskar bedroht. So schufen sie in Oaxaca mit Hilfe von Mittelsmännern, die ihnen auch bei der Beschaffung von Quecksilber Vorspann leisteten, die „Turu Mining Company“, die erste mexikanische Produktionsgesellschaft für Mica. Darüber hinaus betätigte sich Japan im Jahre 1940 in solchem Maße als Einkäufer auf dem Markt von USA, daß mittlere und kleinere amerikanische Firmen vom amerikanischen Micabezug ausgeschaltet wurden. Bis eines Tages der japanischen Einkäufer die Flottenbasis Pearl Harbour aus heiterem Himmel kaputtschlug.
Als die Erschließung neuer Micagruben in Sibirien gemeldet wurde, beruhigte die Fachpresse Europas und Amerikas ihre Leser mit dem Argument, daß die Russen sogar unfähig seien, ihre alten Bergwerke in Betrieb zu halten. Die gleichzeitige Erfindung russischer Wissenschaftler, synthetische Mica herzustellen, wurde einerseits als übliche Sowjetpropaganda kommentiert, andererseits als Beweis dafür, daß die Sowjetunion nicht genug natürliche Mica besitze. Im Russisch-Finnischen Krieg ergänzte die Fachpresse die allgemeine Voraussage vom Debakel der Roten Armee mit dem Gutachten, daß die Russen nicht imstande seien, einen längeren Krieg zu führen, weil sie sich nicht auf dem Weltmarkt mit Mica eingedeckt haben.
Nun, der Krieg ist ein längerer Krieg geworden, und im Krieg wie im Frieden, in der sowjetischen wie in der übrigen Welt, auf Erden, in den Gewässern und in den Lüften nimmt die Mica führend daran teil. Hat auch der größere Teil der Menschheit den Namen Mica noch nie gehört, so steht dennoch dieser Name in der Rangliste der strategischen Stoffe vor Gummi, Zinn und Petroleum. Jeder Versuch, die Mica aus USA zu entführen, wird als qualifizierter Hochverrat bestraft.
Die Verlustliste der Mica ist nicht so groß wie die des anderen Kriegsmaterials. Denn im abgestürzten Flugzeug, im gestrandeten Panzerkreuzer, im bombardierten Kraftwerk oder in der zerfetzten elektrischen Lokomotive bleiben, wenn nichts heil bleibt, die Mica-Bestandteile heil und können wieder verwertet werden.
Und weil also Schön-Mica nicht einmal bei diesen Katastrophen gestorben ist, so lebet sie noch heute.
Quellen:
[1] Kisch, E. (1945). Entdeckungen in Mexiko. Verfügbar unter: https://kuenste-im-exil.de//KIE/Content/DE/Objekte/kisch-egon-erwin-entdeckungen-in-mexiko.html?single=1 [04.02.2021].
[2] Kisch, E. (1947). Entdeckungen in Mexiko – Reportagen. Wien: Globus-Verlag.
Abb. 1: Glimmerplatte. „IMG_3515b“ by Denish C is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/